Nationalmannschaft Männer
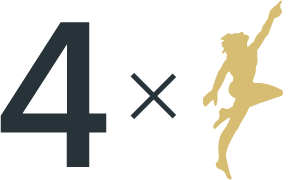
Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft bestätigte ein Jahr vor der Heim-WM ihren Status als Medaillenanwärter und erreichte an der WM in Dänemark und Schweden zum vierten Mal innert zwölf Jahren den Final. Wieder war der grosse Coup zum Greifen nah, doch erneut blieb der Traum von der ersten Goldmedaille unerfüllt. Gegen die USA fiel das einzige und entscheidende Tor erst in der Verlängerung. Stark in der Defensive, effizient im Powerplay und getragen von einem herausragenden Leonardo Genoni im Tor bewies die Mannschaft im Turnierverlauf Charakter, Tiefe und Reife. Die Enttäuschung über Silber zeigt jedoch, wie weit die Schweiz unter Patrick Fischer in den letzten Jahren gekommen ist: vom Überraschungsteam zum dauerhaften Medaillenanwärter, der auch dank der starken NHL-Fraktion, aber auch dem gestiegenen Niveau in der Schweizer Liga dauerhaft zur Weltspitze gehört. Vielleicht gelingt die Krönung an der Heim-WM 2026.
Gemeinsam Grosses leisten
Nie zuvor stand eine Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft näher am WM-Titel als im Frühling 2018. Das Team von Headcoach Patrick Fischer hat in Dänemark gezeigt, was mit Glauben und Teamgeist alles möglich ist und erntete dafür landauf landab viel Lob und Anerkennung.
Fünf Jahre nach der 1:5-Finalniederlage gegen Schweden bekam die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft 2018 in Kopenhagen erneut die Chance, zum ersten Mal in der Geschichte Weltmeister zu werden. Nachdem sie im Viertelfinal Finnland und im Halbfinal Kanada ausgeschaltet haben, verpassten die Schweizer den ganz grossen Coup im Final anders als 2013 nur ganz knapp.
Mit Mut, Überzeugung, einer erfrischend offensiven Spielweise und dem Glauben daran, Grosses erreichen zu können, drängten die «Eisgenossen» die bis dato im Turnier ungeschlagenen Schweden an den Rand einer Niederlage. Das Drama endete im Penaltyschiessen und mit bitteren Tränen für die Schweizer, die für einen unglaublichen Effort nicht mit dem Maximum belohnt wurden.
In Stockholm 2013 hatten sich die Schweizer mit dem Finaleinzug selbst überrascht. Fünf Jahre später in Kopenhagen traten sie voller Überzeugung an, im Wissen, Weltmeister werden zu können. Entsprechend sass der Frust über den geplatzten Gold-Traum nach der neuerlichen Finalniederlage tiefer.
Als Baumeister dieses Erfolgs gilt Nationaltrainer Patrick Fischer. Der kommunikative Zuger hat es mit seinen mutigen Voten und seiner Überzeugung, dass sich die Schweiz im internationalen Vergleich nicht verstecken muss, geschafft, die Mentalität des Nationalteams nachhaltig zu verändern. Es ist ihm gelungen, seinen kecken Optimismus auf die neue Generation zu übertragen. Damit hat er ein Klima geschaffen, dass Spieler - ob sie ihr Geld in der NHL oder in der Schweiz verdienen - das Trikot mit dem weissen Kreuz auf rotem Grund mit Enthusiasmus tragen. Diese Begeisterung hat sich auch auf das Publikum übertragen.
Nie zuvor stand eine Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft näher am WM-Titel als diesen Frühling. Als Lohn erhielten die Silberhelden von Kopenhagen die Auszeichnung als Team des Jahres überreicht.
«Die Mentalität ist geprägt von der Überzeugung und dem Glauben daran, Grosses erreichen zu können», kommentierte der Tages-Anzeiger nach dem Gewinn der zweiten WM-Silbermedaille innerhalb von fünf Jahren treffend. Den ganz grossen Coup im Final verpassten die Schweizer anders als 2013 nur ganz knapp. Erst im Penaltyschiessen mussten sie sich den Schweden geschlagen geben. Fünf Jahre zuvor waren sie beim 1:5 gegen denselben Gegner noch chancenlos geblieben.
In Stockholm hatten sich die Schweizer mit dem Finaleinzug selbst überrascht. In Kopenhagen traten sie voller Überzeugung an, im Wissen, Weltmeister werden zu können. Entsprechend sass der Frust nach der neuerlichen Finalniederlage tiefer. Dennoch durfte die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer stolz sein.
Wenn eine vermeintlich kleinere Eishockey-Nation innerhalb von fünf Jahren zweimal in den WM-Final vorstösst, dann ist dies kein Zufall. Mittlerweile besitzt die Schweiz eine hohe Zahl an Spielern mit NHL-Erfahrung. Acht Spieler des Silberteams kamen letzten Winter in der besten Liga der Welt zum Einsatz. So viele Akteure mit NHL-Erfahrung waren nie zuvor zu einer WM eingerückt.
Es wäre vermessen zu erwarten, dass die Schweiz nun jedes Jahr um Medaillen mitspielt. Wie schmal der Grat zwischen Top oder Flop ist, zeigte sich an den Olympischen Spielen (Out in den Achtelfinals). Wenn ein Grossteil des Kaders nicht in Form ist und Verstärkungen aus Nordamerika fehlen, dann wird selbst eine Top-8-Klassierung zur Herausforderung.
Mit dem Gewinn der WM-Silbermedaille gelang dem Schweizer Eishockey-Nationalteam an der WM in Stockholm ein veritabler Coup. Es erhielt damit zum zweiten Mal nach 1986 die Auszeichnung als Team des Jahres.
1986 reichte dem Nationalteam der Aufstieg in die A-Gruppe, um zum Schweizer Team des Jahres erkoren zu werden. 27 Jahre später schafften die Schweizer zum ersten Mal seit 1953 den Sprung auf das WM-Podest. Erst der zweifache Olympiasieger Schweden vermochte das Team von Trainer Sean Simpson zu stoppen – mit einem 5:1 im Final von Stockholm.
Allein die Leistung beim 3:0 gegen die USA im Halbfinal ist die Auszeichnung als Team des Jahres wert. Der neunte Sieg im neunten Spiel war das Meisterstück des Nationalteams und die wohl beste Leistung einer Schweizer Eishockey-Equipe aller Zeiten. Besser als an diesem Abend kann man im Prinzip nicht Eishockey spielen. Der erstmalige Einzug in einen WM-Final und die zweite Silbermedaille in der Ver-bandsgeschichte (nach 1935) war der verdiente Lohn für einen perfekten Auftritt.
Nach dem verlorenen Final weinten die Schweizer im ersten Moment bittere Tränen. Spätestens am Tag danach glänzte die Silbermedaille bereits golden. Stolz präsentierte sich das Team an einem triumphalen Empfang am Flughafen Kloten – im Wissen, ein Sportmärchen geschrieben, die grösste Sensation im Schweizer Eishockey erzeugt und eine der wertvollsten Leistungen im Schweizer Sport erbracht zu haben. Für den Eishockey-Verband ist dieser Erfolg unbezahlbar und der verdiente Lohn für die lange Aufbauar-beit, die er in den letzten 20 Jahren auf allen (Junioren-)Stufen geleistet hat.
Verblüffend war nicht nur die Silbermedaille an sich, sondern insbesondere auch die Art und Weise, wie diese zustande gekommen ist. Anders als bei (vereinzelten) Siegen in den letzten Jahren gegen soge-nannte «Grosse» benötigten die Schweizer in Stockholm kein Glück. Sie überzeugten mit einer nie dage-wesenen Konstanz und geschlossenen Mannschaftsleistungen, bei denen kein Spieler abfiel. Und sie besiegten ihre Gegner auch an Tagen, an denen diese ihre Bestleistungen brachten. Das zeugt von der Reife und Klasse, die die besten Schweizer Spieler mittlerweile haben.
In der Abgeschiedenheit der schwedischen Hauptstadt blieben die Spieler fokussiert. Erst nach der Rück-kehr in die Heimat wurde ihnen bewusst, was sie ausgelöst hatten. Die Eishockey-Euphorie gipfelte im Final, der 1,2 Millionen Schweizer vor den Fernseher lockte und für die (bisher) beste Quote des SRF in diesem Jahr sorgte.





